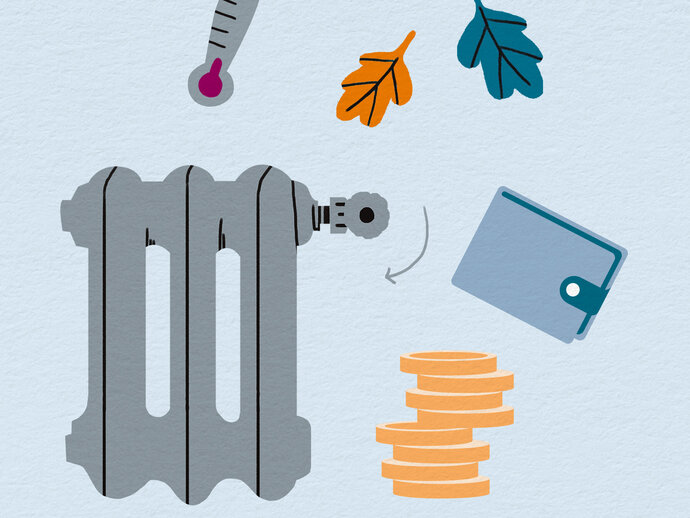Im Pariser Klimaabkommen haben sich die Staaten der Welt im Jahr 2015 dazu verpflichtet, den globalen Temperaturanstieg auf "deutlich unter 2 Grad über dem vorindustriellen Niveau" zu halten. Sie wollen “Anstrengungen unternehmen”, um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die Gültigkeit der Ziele des Pariser Klimaabkommens und die daraus erwachsende Verpflichtung zum wirksamen Klimaschutz durch alle Nationen wurde im Juli 2025 durch ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofes (IGH) der Vereinten Nationen in Den Haag bestätigt.
Das strengere 1,5-Grad-Limit war eine zentrale Forderung kleiner Inselstaaten, die am stärksten vom Klimawandel bedroht sind. Für diese Länder bedeutet jedes Zehntelgrad einen erheblichen Unterschied, weil damit u.a. ein Anstieg des Meeresspiegels und damit die Unbewohnbarkeit der Lebensräume verknüpft ist.
Aber auch Europa ist mit Klimarisiken konfrontiert. Sie zeigen sich schon heute, etwa durch schwere Überschwemmungen, Grundwasserrückgang und Waldbrandgefahren. Laut einem Bericht des Weltklimarats aus dem Jahr 2025 droht eine Erderwärmung, welche die 1,5-Grad-Grenze im langjährigen Jahresmittel übersteigt, möglicherweise schon im Jahre 2030.
Um die Folgen des Klimawandels zu begrenzen, ist es erforderlich die Treibhausgas-Emissionen aus fossilen Quellen drastisch und zügig zu senken und so den Temperaturanstieg zu begrenzen. Gleichzeitig sind Aktivitäten und Investitionen zur Klimaanpassung notwendig.
Der CO2-Emissionsfaktor für Energieträger wie Heizöl oder Ökostrom zeigt, welche Mengen Treibhausgase (THG) pro verbrauchte Kilowattstunde (kWh) ausgestoßen werden. Die Treibhausgase werden dabei in sogenannten CO2-Äquivalenten (CO2e) angegeben; sie beinhalten damit alle wichtigen Treibhausgase, wie bspw. CO2, Methan und Lachgas. Jedes Treibhausgas wird dafür nach der jeweiligen Klimawirkung gewichtet und in die entsprechende Menge CO2e umgerechnet.
Für die Berechnung der Treibhausgas-Emissionen der Nordkirche werden auch die Emissionen berücksichtigt, die in den Vorketten – also bei der Bereitstellung der Energie und Rohstoffgewinnung – entstehen. Das entspricht den Empfehlungen der EKD, die entsprechende Emissionsfaktoren erarbeiten lässt und auf der Webseite der EKD veröffentlicht hat.
Als CO2-Preis wird die gesetzliche Bepreisung von Treibhausgasemissionen bezeichnet, die durch die Nutzung von fossilen Heizbrennstoffen und Kraftstoffen – Heizöl, Erdgas und Flüssiggas, sowie Benzin und Diesel – entstehen. Für die Jahre 2021 bis 2026 ist der Preis pro Tonne CO2 gesetzlich festgelegt. Er steigt über die Jahre stetig an. Ab 2027 soll sich der CO2-Preis im Einklang mit den EU-Regelungen über die staatliche Versteigerung der Emissionsrechte an die Brennstoffhändler und über den freien Handel von Emissionsrechten bilden.
Die Kosten für den CO2-Preis geben die Energielieferanten an die Endverbraucher weiter. Mieter und Vermieter müssen die Kosten anteilig tragen, abhängig von der Gebäudeeffizienz. Wie sich der CO2-Preis für typische Gebäude von Kirchengemeinden berechnet, ist in der Kurzinfo CO2-Preis nachzulesen.
Die staatlichen Einnahmen aus der CO2-Bepreisung werden genutzt, um die Umlage für die Finanzierung erneuerbarer Stromerzeugung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz zu finanzieren. Dadurch sinken die Strompreise für den Endkunden. Zusätzlich werden Förderprogramme für den Heizungstausch und andere Klimaschutzinvestitionen mit den Einnahmen finanziert.
Energiecontrolling bedeutet, den Energieverbrauch zu messen und auszuwerten. Es bildet damit die Grundlage für die Planung von Maßnahmen und Strategien für das Energiemanagement. Energiemanagement hilft, den Energieverbrauch, die Treibhausgasemissionen und die laufenden Energiekosten zu senken und liefert Daten für kurz- und mittelfristige Planung der Betriebsführung und von Investitionen.
Im Energiecontrolling werden Daten wie Monats-, Quartals- und Jahresverbräuche erfasst. Auch Kennwerte wie der Energieverbrauch pro Quadratmeter oder pro gefahrene Strecke werden berechnet. Diese Daten werden in Berichten zusammengefasst und regelmäßig aktualisiert. Diese Aktualisierung richtet sich nach der Häufigkeit der Verbrauchserfassung. Energiecontrolling wird meist mit spezieller Software durchgeführt, die Arbeitsabläufe vereinfacht. In der Nordkirche wird überwiegend die Software “Interwatt”, teilweise auch das “Grüne Datenkonto” genutzt.
Energiemanagement baut auf dem Energiecontrolling auf. Die Ergebnisse des Energiecontrolling fließen in einen strukturierten Prozess ein, um Maßnahmen zu entwickeln, umzusetzen und damit festgelegte Ziele zu erreichen. Zentrale Ziele sind Kosteneinsparungen und möglichst geringe negative Umwelteinwirkungen. Die so entwickelte Strategie und die Wirksamkeit der umgesetzten Maßnahmen werden regelmäßig anhand der Energieberichte überprüft und falls notwendig angepasst, um die Ziele zu erreichen.
Energie sparen bedeutet, weniger Energie zu verbrauchen. Dies kann durch energieeffizientes Verbrauchsverhalten oder technische Maßnahmen erreicht werden, die zu einem sparsameren Betrieb von technischen Geräten, wie Kühlschränken, Automotoren oder Heizungsanlagen führen, ohne dass damit ein Komfortverlust verbunden ist.
Eine weitere Form des Energiesparens basiert allein auf individuellen Verhaltensänderungen und veränderten Erwartungen. Beispiele dafür sind, die Heiztemperatur zu senken und stattdessen einen Pullover überzuziehen oder das Fahrrad anstelle des Autos zu nutzen. Diese Form des Energiesparens kann also durchaus mit einem bewussten Verzicht verbunden sein. Individuelles Energiesparen birgt aber oft auch Chancen durch neue Erfahrungen und Gewohnheitsänderungen.
Energieeinsparung kann grundsätzlich in allen Handlungsbereichen erzielt werden – ob Gebäude, Mobilität oder Beschaffung. Den Energieverbrauch durch Effizienzverbesserungen zu verringern, ist neben dem Umstieg auf erneuerbare Energie ein zentraler Schritt auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität. Besonders im Gebäudesektor gibt es eine Vielzahl von sogenannten nicht- und gering-investiven Maßnahmen, insbesondere zur Verbesserung der Heizsysteme. Sie sparen ohne nennenswerte Investitionen Energie ein, reduzieren damit die laufenden Kosten und tragen erheblich zur Erreichung der Klimaschutzziele der Nordkirche bei.
Erneuerbare Energie benennt jede Art von Energie, die sich durch natürliche Prozesse erneuert. Dazu zählt Energie aus nachhaltigen Quellen wie Wasserkraft, Windenergie, Sonnenenergie, Biomasse und Erdwärme. Im Gegensatz zu den fossilen Energieträgern Erdöl, Erdgas, Stein- und Braunkohle sowie dem Kernbrennstoff Uran verbrauchen sich diese Energiequellen also nicht.
Erneuerbare Energien sind entscheidend für die Erreichung von Klimaschutzzielen. Sie helfen, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Umwelt zu schonen, was für eine nachhaltige Zukunft unerlässlich ist.
Gesamtkostenrechnung oder Vollkostenberechnung bezeichnet eine Methode, um die Gesamtkosten eines Produkts oder einer Anlage über deren gesamte Lebensdauer hinweg zu berechnen und als eine Grundlage für eine Investitionsentscheidung zu nutzen. Das bedeutet, dass nicht nur die Anschaffungskosten betrachtet werden, sondern auch alle weiteren Kosten, die während der Nutzung, Wartung und Entsorgung anfallen. So wird sichtbar, dass energieeffiziente Geräte oder Bauweisen insgesamt oft günstiger sind, auch wenn sie anfangs teurer erscheinen.
Graue Energie ist die gesamte Energie, die benötigt wird, um ein Produkt herzustellen oder eine Dienstleistung anzubieten. Am Beispiel eines Gebäudes erläutert, umfasst Graue Energie die Energie, die zur Herstellung der Baumaterialen, deren Transport und den Bau des Gebäudes benötigt wird. Aber auch die nach der Nutzung für den Abriss verbrauchte Energie zählt dazu.
Eine Zustandsänderung des globalen Klimasystems kann das Überschreiten kritischer Schwellen zur Folge haben: sogenannte Kippunkte, die zu abrupten und drastischen Klimaänderungen führen.
Sind die Kippunkte einmal überschritten, sind die ausgelösten Folgen nicht mehr umkehrbar. Das bedeutet konkret, dass die Temperaturen im Jahresdurchschnitt nicht wieder zurückgehen, starke Unwetter oder Dürren Teil unserer Realität bleiben. Kippunkte sind u.a. das Abschmelzen der Eisschilde in Grönland und der Antarktis oder das Auftauen der Permafrostböden. Sie verstärken die Erderwärmung zusätzlich.
Durch den Klimawandel kommt es vermehrt zu Hitze, Starkregen oder Stürmen. Mit der Klimaanpassung wird auf diese Risiken reagiert, indem Maßnahmen eingeführt werden, die die Ereignisse abzumildern versuchen.
Ein Beispiel ist, dass Flächen entsiegelt und begrünt werden, damit der Boden Regenwasser aufnehmen und bei Hitze die Umgebung kühlen kann. Auch im Bereich der Gesundheitsvorsorge können z.B. Wasserspender aufgestellt oder kühle Orte eingerichtet werden, damit die größten Auswirkungen bei Hitze reduziert werden können. Im Gebäudebereich können verschiedene Maßnahmen vorgenommen werden, insbesondere für eine verbesserte Dämmung gegen Hitze, z.B. indem Dächer oder Fassaden begrünt werden, Fenster mit Läden verschattet oder hitzeabweisende Dämmstoffe verwendet werden.
Das Konzept der Klimagerechtigkeit macht deutlich, dass die Klimakrise auch als eine Frage der Menschenrechte und der Gerechtigkeit ist – und nicht allein als Umweltproblem oder eine wirtschaftliche Herausforderung wahrgenommen werden kann. Denn diejenigen, die am wenigstens zur Erderhitzung beitragen, müssen die Hauptlast ihrer Folgen tragen.
Das gilt allen voran für Menschen im globalen Süden, deren Wirtschafts- und Lebensgrundlage schon heute durch die Folgen des Klimawandels beschränkt wird. Gleichermaßen gilt das für Mitgeschöpfe wie Tiere und Pflanzen, sowie für alle kommenden Generationen.
Hier geht es zu unserer Themenseite Klimagerechtigkeit
Klimaneutralität ist ein Zustand, bei dem menschliches Handeln keine Auswirkungen mehr auf das Klima hat. Dazu zählt nicht nur Treibhausgasneutralität. Berücksichtigt wird auch das menschliche Handeln, soweit es Einfluss auf andere Klimafaktoren nimmt – wie z.B. die Rückstrahlfähigkeit (Albedo) der Erdoberfläche.
Heute steht bei aktuellen Klimaschutzkonzepten präziser die Treibhausgasneutralität im Fokus, sie ist das angestrebte Ziel.
In der Nordkirche sollen möglichst nur noch Dienstleistungen und Waren eingekauft werden, die unter sozialen Bedingungen hergestellt und zugleich ökologisch und wirtschaftlich sind. Grundlage dafür sind das Klimaschutzgesetz der Nordkirche und die Beschaffungsverwaltungsvorschrift (BeschVwV).
ÖkoFaire Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen gehen mit gutem Beispiel voran. Mitmachen ist dabei ganz einfach: Maßnahmen auswählen, anmelden, Umsetzung dokumentieren, Abschlussgespräch, Auszeichnung – fertig. Alle werden mit Workshops, Tipps und Ideen tatkräftig von einem Team begleitet. Am besten gleich anmelden. Wir freuen uns auf Sie!
Aus dem Lateinischen kommend, bedeutet dieser Begriff “ausreichen”. Bezogen auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist damit gemeint, nur so viel zu nutzen wie wirklich notwendig ist. In einer Kirchengemeinde kann das heißen, bei Veranstaltungen Müll zu vermeiden, Energie zu sparen und Gemeinschaftsräume sinnvoll zu nutzen. So kann die Kirchengemeinde ein Vorbild sein und andere zum nachhaltigen Leben inspirieren.
Mit dem Begriff Treibhausgase (THG) werden verschiedene Gase beschrieben, die zur Erwärmung der Erdatmosphäre beitragen. Sie bilden in unserer Atmosphäre eine Schicht, die ähnlich funktioniert, wie die Glasscheiben eines Treibhauses. Licht kann nahezu ungehindert durch diese Schicht zur Erdoberfläche gelangen und dort in Wärme umgewandelt werden. Diese Wärme kann die Schicht aus Treibhausgasen nur schlecht passieren und bleibt damit zum Großteil in der Erdatmosphäre. Dieser Effekt wird stärker, je mehr Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen.
Die wichtigsten Treibhausgase sind Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4) und Lachgas (N2O). Sie entstehen auf natürliche Weise, aber in großen Mengen auch durch menschliche Aktivitäten wie das Verbrennen von fossilen Brennstoffen (Kohle, Öl, Gas), die Landwirtschaft und die Abholzung von Wäldern.
Seit der beginnenden Industrialisierung wurden enorme Mengen Treibhausgase durch menschliche Aktivitäten in die Atmosphäre ausgestoßen. Zudem wurden natürlichen Senken verringert, beispielsweise durch die Trockenlegung von Mooren oder die Bodenversiegelung. Das ursprüngliche natürliche Gleichgewicht ist gestört und die Erde erwärmt sich immer mehr.
Treibhausgas(THG)-Neutralität ist dann erreicht, wenn nicht mehr THG in die Atmosphäre gelangt, als aus ihr dauerhaft entnommen wird. Es bedeutet, dass das menschliche Handeln das globale Klima nicht mehr beeinflusst. Die kostengünstigste Option Treibhausgas-Neutralität zu erreichen, ist die THG-Emissionen zu verringern, indem der Energie- und Ressourcenverbrauch reduziert und die Verbrennung fossiler Rohstoffe vermieden wird. Die meisten Methoden zum sog. Carbon Capture and Storage, die CO2 aus der Atmosphäre entnehmen und sicher einlagern, sind noch in der Entwicklung und im Vergleich sehr teuer.
Ziel der Nordkirche ist es in den Handlungsbereichen Gebäude, Mobilität und Beschaffung bis zum Jahr 2035 THG-neutral zu sein.